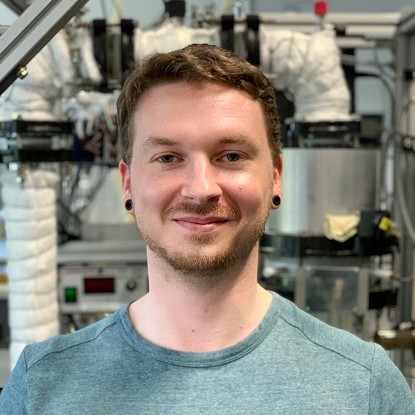Das Modul „Naturwissenschaftler*innen in Gesellschaft, Akademie und Industrie – Hürden und Chancen“ (kurz: NaGAI) befasst sich damit, dass Wissenschaft von Menschen gemacht wird, die dem Anspruch der Objektivität nicht immer ohne Weiteres gerecht werden können.
Das beeinflusst
- die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung (Auswahl von Forschungsthemen, Interpretation von Daten, (Nicht-)Publikation bestimmter Ergebnisse, …),
- die Wege, die Naturwissenschaftler*innen beruflich gehen können (Auswahlprozesse bei Bewerbungen und Beförderungen, mentale Belastung, …),
- die Art und Weise, in der die Öffentlichkeit Naturwissenschaftler*innen wahrnimmt (Glaubwürdigkeit, Verständlichkeit, …).
Die 2020 geborene Ringvorlesung behandelt daher Themen wie die Wahrnehmung von Naturwissenschaftler*innen in Medien und Gesellschaft, Netzwerken und Gleichstellungsbemühungen in Akademie und Industrie, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Machtmissbrauch und Belästigung, psychische Gesundheit, Unconscious Biases, Diskriminierung, Stereotype und Diversität sowie Rahmenbedigungen von Arbeit als ausgebildete Wissenschaftler*innen.
Die eingeladenen Redner*innen kennen sich in den verschieden Formen von Diskriminierung und Diversität aus und betätigen sich in den unterschiedlichsten Feldern; von Professor*innen über Unternehmensberater*innen, Wissenschaftskoordinator*innen und Vertreter*innen von Forschungsinstituten und NGOs ist alles dabei. Natürlich gibt es neben den Gastvorträgen in jeder Sitzung genug Zeit für Diskussionen mit und Fragen an die Speaker.
Die Vorlesung findet ab dem 16.10.24 mittwochs in der Regel um 11:40 Uhr statt und wird via Zoom abgehalten. Einbringen können sie alle Studierenden für 2 CP gegen Vorlage eines Lerntagebuchs in den unbenoteten* Wahlbereichen der Bachelor- und Master-Studiengänge; auf TUCaN findet sich die Veranstaltung unter der Nummer 07-00-0052-vl. Mitschnitte der Veranstaltungen sowie Möglichkeiten zur Diskussion finden Teilnehmer:*innen im zugehörigen Moodle-Kurs. Dieser ist ebenfalls zugänglich für Externe, wenn sie sich vor dem Aufrufen des Kurslinks über einen Gast-Account (unten auf „Anmelden als Gast“ klicken) einloggen.
Sollten Sie Probleme mit dem Zugang haben, melden Sie sich gern per Mail bei den Verantwortlichen (siehe Schaltfläche „Kontakt“).
Wir freuen uns auf Sie!
* Wenn Ihre Studienordnung nur einen benoteten Wahlbereich vorsieht, sprechen Sie bitte im Vorfeld mit Ihrem Studienbüro ab, ob es eine Sonderregelung für die Teilnahme an diesem Modul geben kann. Falls das Wahlangebot im Studium Generale Bereich beschränkt ist, geben Sie uns gern Bescheid und stellen Sie möglichst frühzeitig einen Antrag auf Anrechnung bei Ihrem Studienausschuss.
---
Zoom-Daten: werden bald bekannt gegeben
https://tu-darmstadt.zoom-x.de/j/62736332138
Meeting-ID: 62736332138
Kennwort: 560758
Mobile Schnelleinwahl: +496938980596,,62736332138# Germany
Einwahl nach aktuellem Standort: +496938980596 Deutschland
Ortseinwahl suchen
---
Die Aufzeichnung der Vorträge werden für TU-Interne mit (automatisch erstellten) Untertitel versehen über Panopto im Moodle-Kurs hochgeladen. Diskussionen werden anonymisiert protokolliert ebenfalls dort veröffentlicht. Innerhalb der Sitzungen bemühen wir uns, schriftliche Beiträge auch vorzulesen. Innerhalb der Meetings können automatische live Untertitel aktiviert werden.
Wenn Sie weitere Unterstützungsmöglichkeiten brauchen, um NaGAI gut rezipieren zu können, lassen Sie es uns gern persönlich oder über die anonyme Feedback-Funktion im Moodle-Kurs wissen. Wir wollen unser Bestes tun, um allen Interessierten eine volle Teilhabe zu ermöglichen, und sind immer willens dazuzulernen!
| 16.10.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Wissenschaft & Gesellschaft [DE] |
|
|
| 23.10.24, 14:00 – 15:30 Uhr | Ethische Forschung: Dual Use [DE] |
|
|
|
|
| 30.10.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Klimakrise & Forschung [DE] |
|
|
|
|
| 06.11.24, 11:40 – 13:10 Uhr | KI in Forschung und wissenschaftlichem Schreiben [DE] |
|
|
|
|
| 13.11.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Studentisches Engagement (Podiumsdiskussion) [DE] |
|
|
| 20.11.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Kompetenzvermittlung in MINT [DE] |
|
|
|
|
| 27.11.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Barrierearm MINT vermitteln [EN] |
|
|
| 04.12.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Machtmissbrauch im Wissenschaftssystem [DE] |
|
|
|
|
| 11.12.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Selbstbehauptung gegenüber Machtmissbrauch (Workshop) [DE] |
|
|
| 18.12.24, 11:40 – 13:10 Uhr | Psychische Gesundheit [DE] |
|
|
|
|
| 15.01.25, 11:40 – 13:10 Uhr | Neurodiversität [DE] |
|
|
| 22.01.25, 11:40 – 13:10 Uhr | Rassismus & Religion [DE] |
|
|
|
|
| 29.01.25, 11:40 – 13:10 Uhr | Die Rolle des Mannes auf dem Weg zur Chancengerechtigkeit [DE] |
|
|
| 05.02.25, 11:40 – 13:10 Uhr | Vereinbarkeit von Familie und Beruf [DE] |
|
|
|
|
| 12.02.25, 11:40 – 13:10 Uhr | Berufseinstieg und Karriereperspektive |
|
|
|

Wissenschaftsmanagement und -kommunikation - Arbeiten an einer spannenden Schnittstelle
Dr. Julia Krohmer
Der Austausch zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaft hat in der heutigen Wissensgesellschaft eine besondere Relevanz, da wissenschaftliche Erkenntnisse immer stärker in gesellschaftliche Debatten und Entscheidungen einfließen oder dies zumindest sollten. Der Vortrag beleuchtet, welche Möglichkeiten die Arbeit in Wissenschaftsmanagement und -kommunikation bietet, diesen Austausch kreativ mitzugestalten. Auch wird diskutiert, welche Facetten Tätigkeiten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft haben können und wie dies eine attraktive Lösung ist, wenn man wissenschaftsnah, aber nicht selbst forschend arbeiten möchte.
Beispielhaft wird zudem das Senckenberg-Programm „Wissenschaft und Gesellschaft“ vorgestellt, das Formate wie Citizen Science, Politikberatung und Transfer integriert und so den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft sehr breit führt. Schließlich wird betrachtet, wie Forschende, die sich noch intensiver in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einbringen möchten, sich in Initiativen wie Scientists for Future engagieren können und wie dieses Engagement gesellschaftlich gesehen und diskutiert wird.
Julia Krohmer studierte in Paris „Lettre Modernes“ (Sorbonne Nouvelle Paris III) und an der Universität Bayreuth Geoökologie. Sie promovierte an der Goethe-Universität in Frankfurt im Rahmen des Sonderforschungsbereichs „Westafrikanische Savanne“ zum Thema „Umweltwahrnehmung und -klassifikation bei Fulbergruppen in verschiedenen Naturräumen Burkina Fasos und Benins (Westafrika)“. Nach einigen nichtwissenschaftlichen Jahren in Nordjapan übernahm sie 2007 die Koordination der Bildungskampagne „Biodiversitätsregion Frankfurt/ RheinMain“ an der Goethe-Universität und wechselte Ende 2008 in die Transferstelle des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums (SBiK-F). Seit 2015 ist sie als Wissenschaftskoordinatorin bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung unter anderem für Transfer, Veranstaltungen und Vernetzung zuständig. Im Zuge einiger Citizen-Science-Projekte zum Thema Stadtnatur, mit denen das öffentliche Bewusstsein für den Wert der städtischen Biodiversität geschärft werden soll („Krautschau“, „MainStadtbaum“), hat sie sich umfassend mit Vielfalt, Wert und Bedeutung von Stadtnatur beschäftigt und hierzu auch ein Buch im Kosmos-Verlag veröffentlicht.
Sie hat die Scientists for Future Frankfurt mitgegründet und ist hier weiterhin aktiv, ist Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft (Co-Sprecherin AK Nachhaltigkeit), Radaktivistin und aktiv beim Klimaentscheid Frankfurt (AG Stadtgrün).

Über den Rand geschaut: Soziale und ökologische Auswirkungen von Biotechnologien
Judith Düesberg
Die Arbeit und Forschung mit und an genetischem Material berührt viele sensible Punkte und wirft soziale und ökologische Fragen auf. Je nach Anwendungsgebiet sind diese Fragen mehr oder weniger offensichtlich und nehmen in den medialen Debatten unterschiedlich viel Raum ein. Wir vom Gen-ethischen Netzwerk beschäftigen uns mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Gentechnik und werfen einen Blick auf Aspekte, die im öffentlichen Diskurs oft unterrepräsentiert sind. In meinem Vortrag möchte ich anhand von Beispielen aus der Landwirtschaft und der Medizin zeigen, dass Forschung nicht isoliert stattfindet, sondern in gesellschaftliche Prozesse eingebunden ist. Woher kommen die Gensequenzen, mit denen ich arbeite? Welche Probleme können Gensammlungen mit sich bringen? Wer entscheidet über die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen? Ich möchte dazu einladen, über den Rand der Petrischale zu schauen und zu entdecken, welche Folgen die Arbeit mit biologischem Material haben kann.
Judith Düesberg ist seit 2018 Referentin für Landwirtschaft und Lebensmittel beim Gen-ethischen Netzwerk e.V. und beschäftigt sich hier vornehmlich mit den Themen Gentechnik in der Landwirtschaft und in der Natur sowie dem Zugang zu genetischen Ressourcen. Sie hat Biologie im Bachelor und Ökologie, Evolution und Naturschutz im Master studiert.
Das Gen-ethische Netzwerk e.V. ist ein spendenfinanzierter Verein, der Wissen zu Bio-, Gen- und Fortpflanzungstechnologien für die interessierte Öffentlichkeit aufbereitet. In Zusammenarbeit mit feministischen und ökologischen Bewegungen ermöglicht es differenzierte Debatten, die die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologien ins Zentrum stellen. Das Gen-ethische Netzwerk setzt sich ein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Bio-, Gen- und Fortpflanzungstechnologien; eine gerechte, nachhaltige und solidarische Zukunft für alle sowie diverse Perspektiven in Politik und Wissenschaft.

Ethik und Dual Use - Eine persönliche Perspektive aus der Informatik
Prof. Dr. Matthias Hollick
Die fortschreitende Digitalisierung durchdringt alle Bereiche unserer Gesellschaft. Ein Beispiel hierfür ist das Internet der Dinge (IoT), das die Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schließt und damit als Basis für eine „smarte“ Welt dienen soll. In der Praxis führt dies dazu, dass kontinuierlich große Mengen an Daten oft ungefiltert in digitale „Ökosysteme“ gespeist werden, die von einigen wenigen Anbieter*innen kontrolliert werden. Diese Ökosysteme fungieren als Wächter*innen und regulieren den Zugang zu den Daten oder darauf basierenden digitalen Diensten – oft ohne den Nutzer*innen ausreichende Kontrolle oder Garantien gegen Missbrauch zu geben. Hieraus – und aus vielen weiteren Anwendungen der Informatik – ergeben sich eine Reihe von Fragen zu Ethik und Dual Use.
In meinem Vortrag berichte ich einleitend kurz über meine Tätigkeit in der Ethikkommission der TU Darmstadt, um den Diskussionsrahmen zu setzen. Im Anschluss stelle ich an ausgewählten Beispielen aus der Forschung meiner Gruppe dar, wo wir – teils unerwartet – mit Herausforderungen im Bezug auf Ethik und Dual Use konfrontiert wurden und wie wir diese lösen konnten.
Matthias Hollick ist Professor für Informatik an der Technischen Universität Darmstadt und leitet seit 2009 das Secure Mobile Networking Lab (SEEMOO). Er arbeitet mit seiner Gruppe auf den Themenfeldern mobile und drahtlose Systeme sowie Cybersicherheit und Datenschutz. Die Forschungsarbeiten des Teams von Prof. Hollick wurden in den letzten Jahren mit mehr als 15 Best Paper und Demo Awards ausgezeichnet, unter anderem bei den führenden Konferenzen ACM CHI, ACM MobiCom, ACM IMWUT, EWSN, ACM WiSec und IEEE DOCSS. Die Ergebnisse seiner Forschung fanden ihren Weg in zahlreiche vielbeachtete Open-Source-Softwareprojekte.
Matthias Hollick ist Sprecher und wissenschaftlicher Koordinator des LOEWE-Zentrums emergenCITY. Darüber hinaus ist er stellvertretender Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs „Privacy and Trust for Mobile Users“ und stellvertretender Sprecher des DFG-Sonderforschungsbereichs 1053 MAKI „Multi-mechanisms Adaptation in the Future Internet“. Von 2019 bis 2022 war er Mitglied des Vorstands von ATHENE, dem Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit. Seit 2022 ist er Mitglied der Ethikkommission der TU Darmstadt.

Klimaneutralität an der TU Darmstadt
Caterina Wolfangel
Wie sieht der CO2-Fußabdruck einer technischen Universität aus? Hat die TU Darmstadt ein Klimaneutralitäts-Ziel? Welche Herausforderungen gibt es hin zu einer klimaneutralen TUDa? Im Vortrag und der anschließenden Diskussion werden diese und andere Fragen so weit als möglich beantwortet. An der TU Darmstadt beschäftigen sich im Dezernat V das Energiemanagement Team mit der Umstellung auf eine regenerative Energieversorgung und das Nachhaltigkeitsbüro mit Nachhaltigkeitsthemen – zusammen arbeiten wir u. a. an einer Treibhausgas-Bilanz für die TU Darmstadt.
Caterina Wolfangel ist Nachhaltigkeitsmanagerin im Büro für Nachhaltigkeit an der TU Darmstadt und begleitet mit ihren Kolleg*innen die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Universität und beschäftigt sich mit den Themen Klimaneutralität und Treibhausgas-Bilanzierung. Sie hat mehrere Jahre im Erneuerbare Energien Bereich in Deutschland sowie für eine internationale Naturschutzorganisation im Ausland gearbeitet.

Wie Mensch und Natur Geschichte machen. Zeitgeschichte des Klimas
Prof. Dr. Nicolai Hannig
Die Jahre von 2010 bis 2020 waren das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, womöglich das wärmste seit mehr als 100.000 Jahren. Dabei befindet sich der Verbrauch fossiler Ressourcen weltweit auf einem Höchststand mit einem Ausstoß von rund vierzig Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Gleichzeitig gehen derzeit so viele Windräder ans Netz wie nie zuvor. Allein China produziert mehr Windstrom als Europa und die Vereinigten Staaten zusammen, wenngleich Chinas Kraftwerke alljährlich neue Rekorde der Kohleverbrennung aufstellen. Bekannt ist das Menschengemachte am Klimawandel seit rund vierzig Jahren. Das ihn verstärkende Verhalten scheint jedoch Konjunktur zu haben. Solche Widersprüche ließen sich zuhauf nennen, und sie sind allseits bekannt, was selbst schon wie ein Widerspruch klingt. Doch historisches Interesse weckt der Klimawandel nicht nur durch gefährlich heiße Sommer, durch zunehmende Extremwetter oder durch Windradbau. Er scheint in so gut wie allen Gesellschaftsbereichen angekommen zu sein.
Vor diesem Hintergrund führt der Vortrag in die jüngere Geschichte des Klimawandels ein und erläutert, wie Staaten seit den 1950er-Jahren Wachstumspfade einschlugen, die vor allem durch intensive Ressourcennutzung gekennzeichnet waren. Es gilt also zu erklären, wie wir eigentlich in die gegenwärtige Lage gekommen sind und in welchen Entscheidungskonstellationen frühere Warnsignale geleugnet, relativiert oder abgewehrt wurden.
Nicolai Hannig ist Professor für Neuere Geschichte am Institut für Geschichte der Technischen Universität Darmstadt. Zu seinen Forschungsinteressen zählen die Umwelt- und Stadtgeschichte, Gewalt und Katastrophen, die Medien- und Religionsgeschichte. Er hat Bücher zur Geschichte von Naturkatastrophen und Vorsorge sowie zur Film- und Religionsgeschichte geschrieben.

Einführung in Künstliche Intelligenz, unfair AI & diskriminierende Algorithmen
Klara Krieg
Maschinelle Lernverfahren haben mittlerweile einen festen Platz in unserer Gesellschaft eingenommen: Ob bei der Bewerber*innenauswahl, medizinischen Behandlungsempfehlung oder Kreditwürdigkeitsprüfung, ob Alexa, ChatGPT oder Google – oft verschwimmen die Grenzen zwischen uns und der Technologie um uns herum. Allen Vorteilen zum Trotz werden immer mehr Berichte publik, die von unfairen oder diskriminierenden Algorithmen berichten. Oft sind davon bestimmte Personengruppen überproportional häufig betroffen und werden auf Grund von sensitiven Merkmalen (bspw. Race, Gender) diskriminiert. Ich gebe euch einen Einblick, wie sich unsere internalisierten Stereotype und Vorurteile in AI-basierten Systemen wiederfinden können. Zu Beginn werde ich euch Basiswissen zu Künstlicher Intelligenz vermitteln. Der Vortrag eignet sich für non-Techies, Techies und alle Interessierten!
Klara Krieg verbindet Engineering und KI in ihrer Rolle als AI Program Manager bei Bosch, wo sie an Projekten zu generativer KI und Large Language Models arbeitet. Durch ihren Bachelor in Engineering und den Master in Wirtschaftsinformatik hat sie ihre Leidenschaft entdeckt, komplexe KI-Algorithmen verständlich zu machen und ihre praktische Anwendung zu fördern. Klara engagiert sich zudem in der Forschung zu Fair AI und hält Vorträge, um ihr Wissen zugänglich zu machen. Sie ist auch aktiv in Tech-Netzwerken und setzt sich für Women in Tech und Diversity ein, mit dem Ziel, eine inklusive und gerechte Technologiewelt zu schaffen. Ihre Arbeit und Vorträge zielen darauf ab, nicht nur technisches Verständnis zu vermitteln, sondern auch die ethischen und sozialen Aspekte der Technologienutzung zu beleuchten.

ChatGPT und Co. - Wie Künstliche Intelligenz Bildung verändert
Prof. Dr. Ute Schmid
KI-Systeme finden in immer mehr Lebensbereichen Anwendung und sind spätestens seit ChatGPT auch im Bildungsbereich angekommen. Zum einen können KI-Tools individuelles Lernen unterstützen, zum anderen auch bei Unterrichtsvorbereitung, bei Korrekturen und beim Unterrichtsmanagement unterstützen. Unter dem Begriff „Intelligente Tutorsysteme“ (ITS) wird KI-gestütztes Lernen bereits seit den 1980er Jahren erforscht und auch im Unterricht zum Einsatz gebracht. Klassische wissensbasierte Methoden wurden über die Zeit durch Methoden des maschinellen Lernens ergänzt und inzwischen auch mit generativen Ansätzen kombiniert. KI-gestütztes Lernen kann – richtig um- und eingesetzt – Lernprozesse sinnvoll unterstützen: Introvertierten Kindern kann Stress genommen werden, wenn sie etwa englische Aussprache mit einem KI-System üben, statt vor der ganzen Klasse; in der Grundschule können intelligente Stifte direktes, Feedback beim Schreibenlernen geben; ITS für spezielle Kompetenzbereiche, etwa im Bereich Mathematik oder Grammatik, können Lernen im Problemlösekontext fördern und Fehlkonzepte durch gezielte Rückmeldung adressieren. Ein gut gemachtes ITS basiert auf komplexen KI-Methoden, Theorien und Befunden aus der kognitionspsychologischen Forschung sowie einer geeigneten Einbindung von Fachdidaktiken. Einfachere Lernsysteme basieren dagegen häufig auf Aufgabendatenbanken und Wissensprüfung erfolgt über Auswahlaufgaben statt frei generierte Lösungen. Maschinelles Lernen wird in solchen einfachen Systemen häufig nur für die Generierung individueller Lernpfade eingesetzt, aber nicht für tiefer gehende Kompetenzdiagnostik. Rückmeldung bei Fehlern ist auf das Zeigen der korrekten Antwort reduziert. Solche Systeme bergen die Gefahr, dass Lernen auf Drill und Test reduziert wird – also die Gefahr eines Rückfall in den Behaviorismus. Wird maschinelles Lernen eingesetzt, um aus vorliegenden Daten von Lernenden Vorhersagen über zukünftige Leistungen zu machen (predictive analytics), sollte ebenfalls genauer hingeschaut werden. Solche Ansätze können durchaus hilfreich sein, um Probleme von Lernenden frühzeitig zu identifizieren und entsprechend zu adressieren. Allerdings kann predictive analytics auf verschiedenen Ebenen auch problematische Auswirkungen haben:
(1) Die Genauigkeit und Gültigkeit von Vorhersagen auf Basis gelernter Modelle kann aus verschiedenen Gründen mangelhaft sein: Die Messung komplexer Konstrukte wie Aufmerksamkeit oder Verständnis lässt sich oft nicht sinnvoll über einfache Verhaltensdaten realisieren. Die Daten, mit denen die Vorhersagemodelle trainiert wurden, können unfaire Biases enthalten.
(2) Vorhersagen – egal ob sie zutreffen oder nicht – beeinflussen Lehrkräfte und deren Einschätzung wirkt wiederum auf den Lernerfolg von Lernenden zurück.
(3) Um eine ausreichende Datengrundlage zu haben, ist es notwendig, dass Lernende möglichst viele digitale Daten generieren. Damit besteht die Gefahr, dass das Primat des Didaktischen aufgegeben wird.
Damit wir zukünftige Bildungsprozesse sinnvoll mit KI-Tools unterstützen, ist ein breiter Dialog zwischen Lehrenden, Lernenden, KI-Forschenden, empirischer Bildungsforschung, Fachdidaktiken, EduTech-Firmen und der Bildungspolitik notwendig. Alle genannten Akteurinnen und Akteure benötigen zumindest ein grundlegendes Verständnis von Konzepten und Methoden der KI. Entsprechend ist eine KI-Bildungsoffensive Voraussetzung, damit KI-Systeme für die Bildung entstehen, die Lernende gezielt individuell unterstützen können und dabei Verständnis, Problemlösekompetenz und eigenständiges Denken und Bewerten fördern.
Im Vortrag gebe ich zunächst kurz eine Einführung in das Foschungsgebiet KI, stelle dann ausgewählte KI-Tools vor und zeige daran Chancen auf, aber auch Risiken und wie man diese vermeiden oder reduzieren kann.
Ute Schmid ist Inhaberin des Lehrstuhls für Kognitive Systeme an der Universität Bamberg. Sie lehrt und forscht seit mehr als 20 Jahren im Bereich Künstliche Intelligenz. Forschungsschwerpunkte sind interpretierbares maschinelles Lernen, hybride KI, erklärbares und interaktives maschinelles Lernen und Intelligente Tutorsysteme. Anwendungsgebiete liegen in den Bereichen Bildung, Medizin, industrielle Produktion und Nachhaltigkeit. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Bamberger Zentrums für KI (BaCAI), Mitglied im Direktorium des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation (bidt) und Mitglied im Bayerischen KI-Rat. Für ihre Verdienste in der KI-Forschung wurde sie zum EurAI Fellow und zum GI Fellow ernannt. Ute Schmid engagiert sich seit vielen Jahren für die Förderung von Frauen in der Informatik und hat für die Universität Bamberg den Minerva Gender Equality Award von Infomatics Europe gewonnen. Sie ist Initiatorin und Leiterin der Forschungsgruppe Elementarinformatik (FELI) und engagiert sich seit vielen Jahren in der Vermittlung von Informatik und KI-Kompetenzen an Kinder, Jugendliche und die breite Öffentlichkeit. Für dieses Engagement wurde sie mit dem Rainer-Markgraf-Preis ausgezeichnet.

Systemwandel, Selbstwirksamkeit, soziale Kontakte & Skills: Der vielseitige Nutzen von studentischem Engagement (Podiumsdiskussion)
Florian Lamert, Lilith Diringer, Lukas Rosenberger, Rose Kaufhold
Der Hochschulalltag kann Studierende ziemlich in Atem halten, wenn sie von einer Lehrveranstaltung in die nächste rennen, gute Noten schreiben und am besten in Regelstudienzeit fertig werden wollen. Gleichzeitig kann er ein Umfeld bieten, das hervorragend dazu geeignet ist, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, wichtige Netzwerke zu knüpfen und auch die Welt außerhalb des eigenen Fachbereichs zu erkunden.
Die Panelist*innen Lilith Diringer, Rose Kaufhold, Florian Lamert und Lukas Rosenberger waren alle beim Projekt Freiraum der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL) aktiv und gestalten in vielen weiteren Rollen aktiv ihre Hochschulen in Fachinhalten, Rahmenbedingungen und Forschungsprojekten mit. Sie bieten einen Einblick darein, wie studentisches Engagement außerhalb der Lehrpläne nicht nur zu einer Verbesserung der Institution für künftige Generationen Studierender führen kann, sondern auch eine direkte Bereicherung für sie selbst darstellt: Durch ihre Ehrenämter können sie im Studium gelernte Inhalte anwenden, sich weitere Skills und Kontakte aneignen, berufliche Chancen wahrnehmen und ausbauen, dürfen reisen und, besonders wichtig, machen die Erfahrung, dass ihre Stimme zählt und sie etwas bewirken können.
Florian Lamert erwarb im April 2024 den Abschluss im LaG Biologie und Chemie befindet sich derzeit berufsbegleitend im Studium des M.Ed. Wirtschaftswissenschaft an der Uni Freiburg. Zugleich arbeitet er seit kurzem hauptberuflich an der Uni Duisburg-Essen im Zentrum für Lehrkräftebildung. Er ist langjähriger Fachschaftler und war als solcher in zahlreichen Gremien – u. a. Prüfungsausschuss, Lehramtsrat, Fakultätsrat und Senat – und hat in dieser Zeit auch ein studentisches Mentoring-Angebot erfolgreich etabliert. Außerdem ist er erfahrener studentischer Gutachter und Teamer beim studentischen Akkreditierungspool.
Lilith Diringer hat ein abgeschlossenes Masterstudium in Public Policy und Jazz Voice (University of Denver, USA) und studierte zuvor den BA Internationale Beziehungen an der TU Dresden. Sie war Finanzerin im Fachschaftsrat, Mitglied im Studienrat und studentische Vertreterin für die Studiengangsreform. 2019/20 ihres Studiengangs. Zudem war sie als Digital Changemaker im Hochschulforum für Digitalisierung aktiv – während Corona, was seine ganz eigenen Herausforderungen und Chancen mit sich brachte. Auch in den USA gründete sie ihre eigene Organisation und war in vielen Gremien u.a. zur Auswahl neuer Mitarbeitenden aktiv, sodass sie eine spannende internationale Perspektive mitbringt. Als netzwerk n Nachhaltigkeitscoach und mit dem StartUp ChargeHolidays zum Themenfeld Nachhaltiges Reisen bietet sie deutschlandweit Vorträge und Workshops für Hochschulen an. Außerdem ist sie Young Changemaker bei Ashoka und hat besonders den Changemaker Summit 2024 in Hamburg mitgestaltet.
Lukas Rosenberger hat einen Hintergrund als Altenpfleger in der psychiatrischen Pflege und studiert Berufspädagogik für Gesundheit mit dem Nebenfach Politikwissenschaften & Wirtschaft an der Hochschule Fulda und der Universität Kassel. In verschiedenen studentischen Projekten und Gremien, darunter das Studierendenparlament, der Ausschuss für Soziales und Beratung, der Studierendenrat sowie Verwaltungsrat des Studierendenwerks, konnte er seine wertvolle Erfahrung in Bezug auf Diversität, Chancengerechtigkeit, Inklusion und Zugehörigkeit mit einbringen und unter anderem dadurch aktiv an der Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen mitwirken. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei die Förderung einer inklusiven und gerechten Hochschulpolitik, die allen Studierenden die gleichen Chancen bietet, unabhängig von ihrem Hintergrund.
Rose Kaufhold ist Künstlerin und Forscherin mit einem Hintergrund in Musik, Übersetzungswissenschaften, Philosophie und Neurowissenschaften. Sie studiert aktuell drei Master: Freie Kunst, Philosophie und Rechtstheorie. Sie war universitätspolitisch im AStA der Uni Hildesheim, der Prüfungskommission, der Qualitätskommission und in der Steuerungsgruppe des Inklusionskonzeptes aktiv. Sie hat eine universitätsübergreifend und international agierende Initiative für Studierende mit Behinderung gegründet. Ihr aktueller Fokus liegt auf der Vermittlung bereits gesammelter Erfahrungen und Kompetenzen und in beratender Tätigkeit z.B. als Gutachterin bei der Stiftung Innovation Hochschullehre. Besonders wichtig für ihr Engagement ist Rose die Perspektive, aktiv Veränderung für die Zukunft gestalten zu können.

Kompetenzvermittlung in MINT – Auf die Lehrkräfte kommt es an!
Michael Smolka
Das Science on Stage Festival bietet eine einzigartige Plattform für den internationalen Austausch von MINT-Lehrkräften (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Als Botschafter des gemeinnützigen Vereins Science on Stage werde ich aufzeigen, wie dieses Event innovative Lehrmethoden und -materialien verbreitet und die Vernetzung weltweit fördert.
In diesem Sinne wird auch die Rolle und Gestaltung von Lehre in den MINT-Fachbereichen näher beleuchtet. Der überregionale Austausch fördert den Transfer bewährter Praktiken und innovativer Ansätze, was die Lehrqualität im allgemeinen verbessert. Fortbildungsangebote ermöglichen es u.a. Lehrkräften, sich kontinuierlich weiterzubilden und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Didaktik zu bleiben.
Darüber hinaus wird auch das Berufsfeld der Lehrkraft näher betrachtet – denn nach zahlreichen Schuljahren ist das Bild hierzu oftmals sehr gefestigt, ohne weiter hinterfragt zu werden. Klischees wie der „Halbtagsjob“, das „zu schlecht zu Sein für die richtige Wissenschaft“ oder das „immer recht Haben“ prägen oft das öffentliche Bild von Lehrkräften und beeinflussen die Wahrnehmung ihrer beruflichen Realität. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Stereotypen soll ein differenzierteres Verständnis für die Herausforderungen und Anforderungen des Lehrerberufs gefördert und das Interesse an diesem geweckt werden.
Michael Smolka ist Lehrer für Chemie, Biologie, Natur und Technik am Gymnasium München Moosach, Science on Stage Botschafter und zudem an der LMU involviert.

Mehr Gleichstellung in der Technik – Die konsekutiven Schülerinnen-Projekttage
Luise Riik & Dr.-Ing. Laura D`Angelo
Bereits seit einigen Jahren liegt der Frauenanteil unter den Studierenden am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) der TU Darmstadt deutlich unterhalb des deutschlandweiten Durchschnitts und unter dem internationalen sowieso. Wie lässt sich dieser Trend umkehren? Wir vom dezentralen Gleichstellungsteam ETIT haben hierfür die Schülerinnen-Projekttage ins Leben gerufen. Mit dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung für Schülerinnen der Sekundarstufen I und II möchten wir Mädchen und junge Frauen nachhaltig für ein technisches Studienfach begeistern und möglichst früh die verschiedenen Facetten des Elektrotechnik-Studiums aufzeigen. Dieser Vortrag stellt Konzept, Realisierung und Auswirkungen bis dato dieses Projekts vor.
Luisa Riik promoviert am Fachgebiet Beschleunigerphysik und Laura D’Angelo ist Forschungsgruppenleiterin am Fachgebiet Theorie Elektromagnetischer Felder. Beide sind seit 2023 Mitglieder im dezentralen Gleichstellungsteam am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) und haben letztes Jahr die Hauptorganisation der Schülerinnen-Projekttage übernommen.
Das Gleichstellungsteam ETIT unterstützt Student*innen, Wissenschaftler*innen sowie administrativ-technische Mitarbeiter*innen bei der Durchsetzung der Chancengleichheit aller Geschlechter. Außerdem setzt es sich für die Steigerung unterrepräsentierter Geschlechter in der Elektrotechnik ein, insbesondere für die Erhöhung der Studienanfängerinnenzahlen. Außerdem bringt es neue Impulse ein wie z. B. mit dem jüngst gestarteten Podcastprojekt gleichstellung@etit, das eine Bühne für Gleichstellungsthemen am Fachbereich ETIT und darüber hinaus bietet.

Barrierearm MINT vermitteln
Prof. Dr. Zoe Schnepp
Aus Krankheitsgründen musste der Vortrag von Prof. Dr. Zoe Schnepp leider kurzfristig ausfallen.

Machtmissbrauch wird durch Strukturen im Wissenschaftssystem begünstigt
Nicole Merkle
„Machtmissbrauch in der Wissenschaft“ ist immer noch ein Tabu-Thema, das nicht zuletzt durch die Bewegungen #IchBinHanna und #MeTooScience immer mehr in den öffentlichen Fokus und Diskurs gelangt ist. Trotz allem wird das Thema leider immer noch stiefmütterlich in der Politik und in akademischen Einrichtungen behandelt und meist als Einzelfall von „schwarzen Schafen“ verharmlost. Befasst man sich mit dem Thema intensiver, wird allerdings schnell deutlich, dass Machtmissbrauch erst durch System immanente Strukturen im Wissenschaftssystem (z.B. wiss. Selbst-Verwaltung, steile Hierarchien, prekäre Verhältnisse, etc.) begünstigt und ermöglicht wird und keinesfalls ein Phänomen ist, das nur „Einzelfälle“ betrifft. Machtmissbrauch kann sich in unterschiedlichen Formen und meist auf mehr oder weniger subtile Art äußern, sodass Betroffene oft verunsichert sind und nicht wissen, wie sie den erfahrenen Machtmissbrauch einschätzen sollen, da in ihrem wissenschaftlichen Umfeld ein solches missbräuchliches Verhalten meist als „normal“ angesehen und propagiert wird. Dadurch fühlen sich Betroffene oft hilflos der Situation ausgeliefert. Wie aber können Betroffene und Beobachter von missbräuchlichem Verhalten diesen erkennen und sich dagegen wehren? Der Vortrag diskutiert unterschiedliche Erscheinungsformen von Machtmissbrauch in der Wissenschaft und zeigt mögliche Strategien und Anlaufstellen, um sich gegen diesen effektiv wehren zu können.
Ich bin Postdoktorandin und wissenschaftliche Koordinatorin am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Meine wissenschaftlichen Interessen umfassen Methoden zu maschinellem Lernen, semantischer Wissensrepräsentation und Agenten-basierten Systemen. Aufgrund persönlicher Erfahrungen musste ich mich mit dem Thema „Machtmissbrauch in der Wissenschaft“ auseinandersetzen. Meine Erkenntnis ist, dass auch Ombudspersonen und Stellen wie die „Chancengleichheit“ oder „Konflikt Beratung“ nicht frei von Abhängigkeiten und Vorurteilen zu sein scheinen und gewissen Zwängen und Interessenskonflikten unterworfen sind. Hinzu kommt, dass es keinerlei regulierende Kontrollmechanismen für Lehrstuhlinhaber und Professoren gibt. Aus diesem Grund sehe ich die Notwendigkeit von externen, unabhängigen Anlaufstellen. Ich möchte auf das Thema aufmerksam machen und Menschen unterstützen, die von Machtmissbrauch im akademischen Bereich betroffen sind. Dabei sind mir Offenheit und Transparenz wichtig, denn nur wenn Missstände aufgezeigt werden, kann entgegengewirkt und langfristig etwas verändert werden.

Wissenschaftliches Fehlverhalten als Machtmissbrauch? Rolle und Möglichkeiten von Ombudspersonen
Prof. Dr. Nina Janich
Ja, es geht auch, aber nicht immer nur ums Plagiat: Um das Aufgabenspektrum der Ombudspersonen aufzuzeigen, werden zentrale Aspekte guter wissenschaftlicher Praxis sowie mögliche Verstöße dagegen erklärt. Auch wird die Vorgehensweise in Verdachtsfällen kurz beschrieben. Ein Schwerpunkt der Ausführungen liegt dabei auf der Frage, ob und inwiefern wissenschaftliches Fehlverhalten mit Machtmissbrauch zu tun hat – und inwieweit man diesem als Ombudsperson wirksam begegnen kann.
Prof. Dr. Nina Janich, seit 2004 Professorin für Germanistische Linguistik bzw. Angewandte Linguistik an der TU Darmstadt. Zuvor: 1989-1993 Studium der Germanistik, Publizistik und Geschichte in Marburg und Mainz. Promotion 1997 und Habilitation 2003 in germanistischer Sprachwissenschaft in Regensburg. Forschungsschwerpunkte sind (multimodale) Text- und Diskurslinguistik, Fach- und Wissenschaftskommunikation, Werbelinguistik und Sprachkritik/Sprachkulturforschung.
Seit vielen Jahren Mitglied der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Goethe-Universität Frankfurt sowie Vertrauensdozentin der Studienstiftung des deutschen Volkes an der TU Darmstadt. Seit 2023 eine der Ombudspersonen für gute wissenschaftliche Praxis an der TU Darmstadt, die gemäß der gleichnamigen TU-Satzung als Ansprechpersonen dienen für Beratung, Prüfung und Organisation möglicher Verfahren in Verdachtsfällen auf wissenschaftliches Fehlverhalten.

Belästigung und #MeToo im akademischen System
Franziska Saxler
In diesem Beitrag stellt Franziska Saxler ihr Netzwerk #metooscience vor. Dabei gewährt sie Einblicke in Forschungsergebnisse zu Prävalenzen, psychologischen Wirkmechanismen und aufrechterhaltenden Faktoren von Belästigung im akademischen System. Durch eine Übung werden die Teilnehmenden trainieren, Belästigung schneller zu erkennen, um sich selbst besser zu schützen und an den richtigen Stellen als Allies (Verbündete) eingreifen zu können. Bei einem interaktiven Austausch wird der Status Quo von #metoo im akademischen System diskutiert.
Im Dezember 2021 schlossen sich Franziska, Ira und Victoria zusammen, um metooscience ins Leben zu rufen. Angetrieben wurden sie von der Idee, eine Plattform für Betroffene von Machtmissbrauch im wissenschaftlichen System zu eröffnen, um ihnen Gehör und Solidarität zu verschaffen. Die Ziele waren, für das Thema öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen, sowie psychologische Aufklärung und das Formulieren von politischen Forderungen. Die persönlichen Erfahrungen der drei Frauen im wissenschaftlichen System waren von Diskriminierung und Machtmissbrauch geprägt gewesen, sowie von der Trägheit und dem Unwillen der verantwortlichen Machthabenden und Institutionen, sich zu Betroffenen zu bekennen und aktiv und effizient gegen diese Gewaltformen vorzugehen. Mit metooscience an die Öffentlichkeit zu gehen, war für sie der Schritt vor die Schattenwand und in die Ermächtigung. Die Solidarisierung untereinander war die Schlüsselerfahrung, die sie auch anderen Betroffenen zu Teil werden lassen wollten. Außerdem wollten sie ihre Erfahrungen nutzbar machen – heute beraten sie andere Betroffene und klären Institutionen und Öffentlichkeit über geschlechter-bezogene Diskriminierung auf.
Neben der Wissenschaftskommunikation und dem Support, den metooscience seit 2021 vor allem über Instagram und über ein eigens eingerichtetes anonymisiertes Kontaktformular für Betroffene leistet, entschieden sie sich, mehr Sichtbarkeit für ihre Geschichte zu wagen, um sich vor Anfeindungen und Unterlassungsklagen zu schützen. Ende 2022 erschien ein Artikel im SPIEGEL, in dem sie Teile des von ihnen Erlebten öffentlich machten. Dieser löste eine Welle der öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema Machtmissbrauch in der Wissenschaft aus und ermutigte weitere Betroffene auch aus anderen Branchen ihre Geschichten öffentlich zu machen.

Maßnahmen an der TU Darmstadt zur Förderung psychischer Gesundheit
Diana Seyfarth & Lea Sahm
In der heutigen Wissenschafts- und Arbeitswelt spielt das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit eine wichtige Rolle. Auch für Naturwissenschaftler*innen, die an der Schnittstelle von Gesellschaft, Akademie und Industrie stehen, ist der Umgang mit mentalen Belastungen von Bedeutung. Die Veranstaltung „Psychische Gesundheit“ im Rahmen der Ringvorlesung gibt einen kurzen Einblick in die aktuelle Studienlage zu psychischen Belastungen im akademischen Umfeld sowie prägende Einflussfaktoren, die das Wohlbefinden beeinträchtigen können – von Leistungsdruck bis hin zur Balance zwischen Lernen und Privatleben. Es werden praktische Ansätze und Hilfsangebote für den Alltag an der TU aufgezeigt. Was tun die Hochschule und ihre Akteur*innen, um das Wohlbefinden zu fördern? Welche präventiven und unterstützenden Maßnahmen stehen zur Verfügung, und wie können Studierende und Mitarbeitende aktiv teilnehmen? Diese Veranstaltung stellt konkrete Programme, Beratungsangebote und präventive Kurse der TU vor, die dabei helfen, psychische Belastungen zu verringern und langfristig für eine gesunde Balance zu sorgen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine interaktive Übung, in der Teilnehmende die Möglichkeit haben, ein beispielhaftes wissenschaftlich fundiertes Tool zur Förderung der eigenen psychischen Gesundheit selbst einmal zu erleben. Ziel ist es, nicht nur theoretische Hintergründe zu vermitteln, sondern auch praktische Ansätze erlebbar zu machen, um die eigenen Ressourcen zu stärken. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und bereits an dieser Stelle von den Angeboten der TU zu profitieren.
Diana Seyfarth arbeitet in der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt und verantwortet dort das Themenfeld Mentale Stärke und emotionale Balance. Die Pädagogin und erfahrene Mentaltrainerin entwickelt innovative Konzepte wissenschaftlich fundierter und praxiserprobter Techniken zur Förderung des Wohlbefindens insbesondere bei Lehrenden und Studierenden mit dem Ziel der Etablierung als neue Kulturtechnik in Bildungsinstitutionen.
Sie ist zertifizierte Achtsame Hochschullehrende, zertifizierte Entspannungstrainerin, Expertin für Aromatherapie und gefragte Dozentin für Fragen um mentale Stärke und emotionale Gesundheit auch an diversen weiteren Hochschulen (u.a. TU München, TU Berlin).
Mit ihrer Ausbildung als systemischer Coach und als erfahrene Hochschuldidaktikerin unterstützt sie Menschen dabei herauszufinden, wie sie ihr eigenes Wohlbefinden und das ihres Umfelds fördern können.
Lea Sahm arbeitet in der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt im Themenfeld Mentale Stärke und emotionale Balance. Als Psychologin und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin hat sie sowohl in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als auch in der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet und verfügt über umfassende Erfahrung mit psychischen Erkrankungen. In ihrer Masterarbeit untersuchte sie das Thema Erholung im Kontext von Arbeitsbedingungen.
Ihr Fachgebiet umfasst Resilienz, Positive Psychologie und Stressmanagement. Im Rahmen ihrer Tätigkeit entwickelt Lea Sahm Workshops und Tools, die Studierende dabei unterstützen, mentale Stärke aufzubauen und so langfristig ihre psychische Gesundheit zu fördern.
![Logo des Vereins Mindful[L] aus überlappenden stilisierten Pflastern in rot, rosa, weiß und grün](/media/gst/ringvorlesung_nagai/MindfulL_Logo_500x500.jpg)
Mindful[L]: Studierende für psychische Gesundheit – Erfahrungen und Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung
Moritz Rump
Mindful[L] ist ein Studierendenverein an der Universität Zürich, der sich für den Austausch über psychische Gesundheit einsetzt. In seinem Vortrag stellt Moritz Rump, Co-Präsident, die Ziele und Projekte von Mindful[L] vor, insbesondere die jährliche Mental Health Awareness Week. Moritz teilt Erfahrungen aus der Arbeit mit Studierenden und zeigt Möglichkeiten auf, wie mensch selbst aktiv werden und die mentale Gesundheit an der eigenen Universität fördern kann. Der Vortrag gewährt Einblicke in studentisches Engagement für psychische Gesundheit und lädt zur Diskussion über innovative Ansätze in diesem wichtigen Bereich ein.
Moritz Rump ist seit 1,5 Jahren im Co-Präsidium von Mindful[L] und absolviert zurzeit seinen Master in Psychologie an der Universität Zürich. Neben dem Studium arbeitet er als Gesundheits- und Krankenpfleger im Universitätsspital Zürich.

Neurodiversität und Umgebung: Praktische Fallbeispiele aus dem Führungsalltag
Dr. Judith Rommel
Sie lernen Begrifflichkeiten rund um das Thema Neurodiversität kennen. Neben dem Autismus Spektrum gehören beispielsweise Hochbegabung, Hochsensibilität, Dyslexie, AD(H)S und Synästhesie zur neurokognitiven Vielfalt der Menschen. Sie hören kurz aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema "Neurodiversität und Wohnen” und erfahren, welche Lebens- und Arbeitsbedingungen wichtig sind, damit Menschen ungeachtet ihrer Neurodiversität ihr Leben gesund gestalten können. Als (zukünftige) Führungskraft erhalten Sie durch kurze Fallstudien Impulse für einen sicheren Umgang mit neuroatypischen Teammitgliedern.
Dr. rer. nat. Judith Rommel hat naturwissenschaftliches Multitalent. Ihr Wissen basiert auf dem Studium der Biologie und Mathematik sowie anschliessender Promotion in Chemie-Informatik. Ausgezeichnet mit einem Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung forschte sie mehrere Jahre an der Universität Cambridge (England). Weitere Forschungsaufenthalte führten sie an die Stanford Universität (CA, USA) und das Weizmann Institut (Israel). Bei der Rückkehr nach Deutschland erhielt sie ein Leadership Stipendium der German Scholar Organisation.
Im Moment ist sie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart angestellt. Gemeinsam mit Studierenden im Studiengang Informatik entsteht die gemeinnützige Wohnraumplattform Lilevi, die speziell auf die Bedürfnisse neurodiverser, hochsensibler Menschen eingeht www.lilevi-unique.org.
Mit dem Steinbeis Beratungszentrum Mensch Gesundheit Technik ist sie selbständig, um Menschen durch Innovationskunst Denkräume zu eröffnen und sie in komplexem wissenschaftlichen Terrain zu Klarheit und Sicherheit zu führen.
Als Gründerin und 1. Vorsitzende des BZND Zentrum für Neurodiversität e.V. liegt ihr Entscheidungsfreiheit im Umgang mit Technik sehr am Herzen www.bznd.org. Der Verein BZND e.V. trägt die Wohnraumplattform Lilevi.
Ihr Buch mit dem Titel “Neurodiversität, Hochsensibilität und Wohnen: von angewandter Forschung zu sozialer Innovation” erscheint 2025 im Springerverlag.

Judenfeindschaft – alt und neu
apl. Prof. Dr. Volkhard Huth
Der Terrorangriff der Hamas aus dem Gaza-Streifen heraus hat am 7. Oktober 2023 in dem seit langem schwelenden Konflikt im Nahen Osten eine neue Dimension des Schreckens eröffnet. Zugleich löste er einen noch immer andauernden Krieg aus, leiden gefangene Geiseln und ihre Angehörigen, leidet die Zivilbevölkerung in Gaza und sieht sich die Weltöffentlichkeit dort mit einer humanitären Katastrophe konfrontiert.
Das zugrundeliegende politische Kalkül der Hamas, den von ihr gewaltsam herausgeforderten Staat Israel zu einer Reaktion zu veranlassen, die viele unschuldige Menschen trifft und es ermöglicht, das in Gaza militärisch gegen terroristische Infrastruktur vorgehende Israel weltweit an den Pranger zu stellen, scheint aufgegangen. Ebenso konnte mit dieser Strategie die sich zuvor anbahnende friedliche Kooperation einer Reihe arabischer Staaten mit Israel akut durchkreuzt werden.
Weltweit, auch in Deutschland, ist die Konflikteskalation genutzt worden, im politischen Diskurs hierüber antisemitischen Motiven und Aktionen neuen Auftrieb zu verleihen: Offensichtlich, um unter vorgeblicher Wahrnehmung arabisch-palästinensischer Interessen allgemein Hass gegen Juden zu schüren. Dabei bedient man sich aus dem traditionellen antisemitischen Stereotypreservoir ebenso wie neuerer, vermeintlich antikolonialistisch-emanzipatorisch begründeter Vorstellungsmuster. Sie gipfelten auch hierzulande schon in aggressivem Vorgehen gegen Repräsentanten und Institutionen jüdischen Lebens, von Anschlägen auf Synagogen über Mobbing an Universitäten bis hin zur Beschädigung jüdischer Geschäfte und Restaurants. Wohin soll dies führen, worauf beruhen die antijüdischen Ressentiments – und wie ist ihnen zu wehren?
Diesen Fragen möchte der Beitrag nachgehen: Unter Anlegung historischer Sichtachsen, ohne deren Kenntnisnahme Missverständnisse, Irrtümer und Vorurteile fortgeschrieben werden.
Volkhard Huth promovierte 1989 zum Dr. phil. an der Universität Freiburg und erhielt dort anschließend für drei Jahre ein Postdoktoranden-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, während er zeitweilig als fester Freier Mitarbeiter einer journalistischen Tätigkeit für den Tageszeitung „Südkurier“ nachging. Mitte der Neunziger absolvierte er einen Forschungsaufenthalt als Stipendiat am Deutschen Historischen Institut Paris sowie mehrere Monate als Gastwissenschaftler und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen. Bis 1997 hatte Huth ein Habilitanden-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft inne. 1998-2000 war er wissenschaftlicher Betreuer des Schwerpunkts „Europa/Byzanz“ im Rahmen des von der Volkswagen-Stiftung zur „EXPO 2000“ aufgelegten Projektes »Die Welt im Jahre 1000«.
Ab 1992 erhielt Huth Lehraufträge zur Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit am Historischen Seminar der Universität Freiburg, habilitierte 2001 dort und war in den folgenden Jahren Gastdozent an der Universität Basel, Lehrstuhlvertretung am Historischen Seminar der Universitäten Freiburg und Zürich, Fachdozent des Institute for the International Education of Students für den Studienbereich „Medieval Studies“ an der Universität Freiburg und Lehrbeauftragter für Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Heidelberg.
Seit 2006 ist Huth hauptberuflich Leiter des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und seit 2012 apl. Professor an der TU Darmstadt. Seine wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkte bilden die Geschichte der Wissensvermittlung, speziell der interkulturellen Kontakte; politische Symbolik des Mittelalters und der frühen Neuzeit; Genealogie sowie jüdische Geschichte.

Rassismuskritik: Was muss ich wissen? Was kann ich tun? Was kann meine spezifische Institution leisten?
Prof. Dr. Karim Fereidooni
In diesem Vortrag geht Prof. Dr. Karim Fereidooni auf Möglichkeiten ein, rassismusrelevante Wissensbestände zu verlernen sowie den rassismuskritischen Kompetenzaufbau zu betreiben. Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage: Was müssen Individuen und Institutionen tun, um rassismuskritisch tätig zu sein bzw. einen rassismuskritischen Organisationsentwicklungsprozess zu iniitieren?
Prof. Dr. Karim Fereidooni ist Mitglied der Lehr- und Forschungseinheit Fachdidaktik an der Fakultät für Sozialwissenschaft und zudem kooptiertes Mitglied der Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft.
Seine Forschungsschwerpunkte bilden Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft sowie diversitätssensible Lehrer*innenbildung.
Darüber hinaus hat er die Bundesregierung (Kabinett Merkel IV) in dem Kabinettsausschuss der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Unabhängigen Expert*innenkreis Muslimfeindlichkeit, sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration zum Thema Integration durch Bildung beraten.
Auf Einladung von Bundeskanzlerin Merkel hat Prof. Dr. Fereidooni den 13. Integrationsgipfel der Bundesregierung am 09.03.2021 mit einer Keynote zum Themenfeld „Diversität gestalten, Teilhabe und Partizipation fördern: Erfolgsfaktoren für Zusammenwachsen und Zusammenhalt“ eröffnet.
Er hat am 26.11.2021 den Walter-Jacobsen-Preis in der Kategorie „Innovation“ von der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung erhalten. Der Preis wurde ihm für innovative Forschung und die Verankerung der Rassismuskritik in den Diskurs der politischen Bildung verliehen.
Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Prof. Dr. Karim Fereidooni – gemeinsam mit anderen Mitgliedern des „Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit“ – am 30.06.2023 die wichtigsten Ergebnisse des Berichts „Muslimfeindlichkeit. Eine deutsche Bilanz“ im Schloss Bellevue präsentiert.

Komplizenschaft oder Allyship? - Die Rolle des Mannes im Feminismus
Muriel Aichberger
Seit über 100 Jahren setzen sich Menschen unter dem Sammelbegriff Feminismus für eine gerechtere Gesellschaft ein. Die Ansätze und Zielgruppen sind dabei so unterschiedlich, dass manche von ihnen miteinander unvereinbar sind, und doch kritisieren sie alle das bestehende Werte- und Herrschaftssystem namens Patriarchat.
Während einige Feministinnen Männer vor allem als Problem denken, was durch Studien zu (sexualisierter) Gewalt, Vermögensverteilung oder politischer Macht gestützt wird, sehen andere die ebenfalls belegten, darüber hinausreichenden Gefahren und Nachteile, die das Patriarchat auch für Männer selbst birgt. Sind Männer, die sich nicht feministisch positionieren, also einfach ein Problem oder nur noch nicht ausreichend informiert? Welche Rolle spielen Männer und ihr Verhalten in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und faire Chancen? Der Vortrag schlägt einen Bogen von Connells komplizenhafter Männlichkeit zum zeitgenössischen Verständnis von politischem Empowerment und Allyship und liefert am Ende ein paar praktische Ideen für das persönliche politische Engagement (nicht nur) für Männer.
Muriel Aichberger (er/dey) ist freiberuflicher Vortragsredner, Diversity-Trainer und Experte für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt.
Muriel arbeitet mit Schüler*innen zu gesellschaftlicher Vielfalt und respektvollem Umgang miteinander, vermittelt LGBTIQA+ Community-Wissen durch öffentliche Vorträge zu queerer Geschichte und Kultur, ist Uni-Dozent für Gender- und Queer-Studies und berät Organisationen und Unternehmen zu EDIB-Themen, Anti-Diskriminierung und inklusiver Kommunikation.

Wie vereinbar sind Familie und Wissenschaft? Daten und persönliche Erfahrungen
Dr. Katharina Schwarz & Dr. Jens Lange
Es ist eine Frage, die sich vielleicht jede*r Wissenschaftler*in irgendwann einmal stellt: Will ich mich lieber mehr auf meine Karriere konzentrieren oder eine Familie haben? Oder muss ich mich überhaupt entscheiden? Eine Wissenschaftskarriere scheint in vielerlei Hinsicht besonders schwierig mit Elternschaft oder genereller Care-Arbeit vereinbar: Befristete Verträge, hohe Mobilitätsanforderungen, wenig Sicherheit, aber dafür hohe Leistungserwartungen. Auf der anderen Seite scheint die Wissenschaft auch Vorteile für Eltern zu bieten: Flexible Arbeitszeiten, wenige Deadlines oder familienfreundliche Hochschulen. Wir werden die zwei Seiten dieser Medaille sowohl mit Daten als auch persönlichen Blog-Beiträgen von ParenThesis beleuchten. Schlussendlich können wir dadurch die Frage nicht beantworten, ob sich Wissenschaftler*innen eher auf ihre Karriere konzentrieren oder sowohl Familie als auch Wissenschaftsarbeit anstreben sollten, aber wir können die Argumente für beide Alternativen besser herausarbeiten.
Katharina bekam 2010 ihr Diplom in Biologie nach einem Studium in Würzburg, erhielt 2015 in Hamburg ihren Doktortitel in Systems Neuroscience und arbeitete danach zunächst als Post-Doc und dann als Principal Investigator bis 2024 an der Universität Würzburg und jetzt an der Universität Trier. Ihre Abstecher ins Ausland für Studium und/ oder Forschung beinhalten längere Aufenthalte an der Universitet Umeå, Schweden, am MIT in Cambridge, USA, und an der University of Canterbury in Christchurch, Neuseeland. Sie war bisher nur auf befristeten Verträgen angestellt. Katharina hat drei Kinder, die 2014, 2017 und 2019 geboren wurden.
Jens hat 2012 sein Diplom in Psychologie in Potsdam erhalten. Er promovierte anschließend an der Universität zu Köln und ist nach einem Aufenthalt an der University of British Columbia und Stationen an der Universiteit van Amsterdam und der Universität Hamburg nun erstmals entfristet als Professor an der HMU Health and Medical University Erfurt. Jens hat ein Kind, das 2020 geboren wurde.
ParenThesis ist ein Blog von und für Eltern in der Wissenschaft. ParenThesis möchte auf Basis von individuellen Erfahrungsberichten von Vätern und Müttern in der Wissenschaft darstellen, wie Familie und wissenschaftliche Arbeit vereinbar sein können, aber auch ehrlich zeigen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten es dabei geben kann.
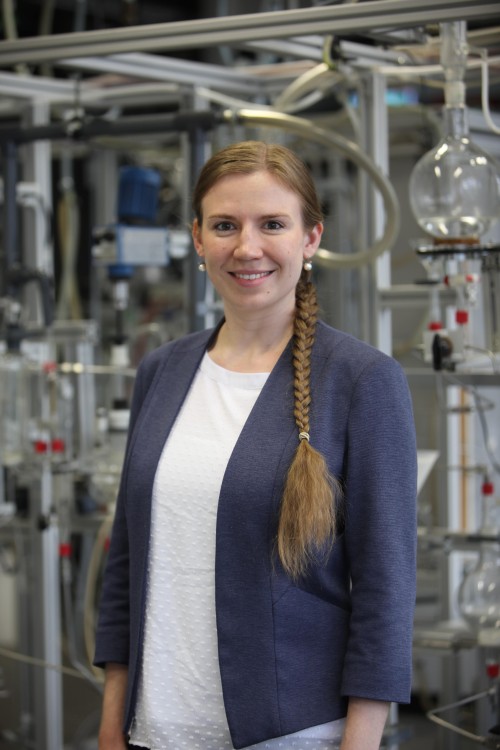
Nachwuchs an der TU in der Chemie: Wie geht das?
Dr. Kristina Zentel & Johanna Viernickel
Nachwuchs an der TU in der Chemie: Wie geht das? Wie lassen sich wissenschaftliche Karrieren und Familienleben vereinbaren? Wir möchten Einblicke in die persönlichen und beruflichen Erfahrungen von uns als Wissenschaftlerinnen und Mütter an der TU Darmstadt bieten. Dabei soll sowohl die Perspektive der Habilitandin als auch die der Doktorandin beleuchtet werden. Wir berichten von Herausforderungen, Lösungen und Angeboten der TU, die uns auf unserem Weg begegnet sind.
Dr. Kristina Zentel hat 2018 an der TU Darmstadt an der Schnittstelle zwischen technischer und makromolekularer Chemie promoviert. Anschließend hat sie von 2018-2021 einen Post-Doc an der Universität Hamburg mit der gleichen Vertiefung absolviert. Währenddessen bekam sie im Sommer 2020 ein Kind. Seit Sommer 2021 ist Kristina Zentel als Habilitandin an den Fachbereich Chemie der TU Darmstadt in Forschung und Lehre zurückgekehrt. Sie leitet eine Nachwuchsgruppe im Bereich der Polymerisationstechnik mit Fokus auf Emulsionspolymerisationen.
Johanna Viernickel hat 2022 ihren Master-Abschluss in Chemie an der TU Darmstadt gemacht. Anschließend startete sie ihre Promotion ebenfalls an der TU Darmstadt in technischer Chemie, betreut von Dr. Kristina Zentel. Im Rahmen ihrer Promotion arbeitet sie experimentell im Labor an der Erforschung von Emulsionspolymerisation. Gleichzeitig beschäftigt sie sich mit der Simulation der ablaufenden Prozesse. Während ihrer Promotion bekam sie außerdem 2023 ein Kind.

Berufsperspektiven für Chemikerinnen und Chemiker
Dr. Carsten Gaebert
Die Hochschulstatistik der GDCh liefert wichtige Zahlen zum Chemiestudium. Im langjährigen Mittel nehmen nur ca. 30-40 % der Absolvierenden eine Tätigkeit in der chemisch-pharmazeutischen Industrie auf. Wie sieht dort der Berufseinstieg aus? Welche Anstellungsalternativen gibt es? Diese Fragen werden in dem Vortrag beleuchtet. Dabei werden Tipps zur Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren (Abläufe, Bewerbungsgespräche) gegeben. Es wird aufgezeigt, welche Rolle hier die Akademikergewerkschaft VAA spielt und wie der VAA einzelne Absolvierende unterstützen kann. Auch wenn die Statistik der GDCh nur das Chemiestudium beleuchtet, gelten die Aussagen des Vortrags auch für Absolvierende anderer naturwissenschaftlicher Studienfächer.
Carsten Gaebert ist als promovierter Chemiker in der chemischen Industrie tätig. Er hat an den Universitäten Münster und Kiel studiert und promoviert. Nach der Promotion hat er in der Zentralen Forschung der Wacker Chemie AG in München als Laborleiter angefangen. Mittlerweile ist er dort stellvertretender Standortleiter, verantwortet den Bereich Services, unter dem u.a. die Themenschwerpunkte Analytik, Toxikologie, Ausbildung, Strahlenschutz, Managementsysteme und betriebliches Vorschlagswesen zusammengefasst sind.
Ehrenamtlich engagiert sich Carsten Gaebert im VAA, ist dort der Vorsitzende der Landesgruppe Bayern und Leiter der Kommission Hochschularbeit. Der VAA vertritt mit rund 30.000 Mitgliedern die Interessen außertariflicher und leitender Angestellter sowie hochqualifizierter Fachkräfte und junger Akademiker*innen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie und den angrenzenden Branchen. In der Akademikergewerkschaft VAA profitieren die Mitglieder von Tarifverträgen mit guten Einstiegsgehältern und überdurchschnittlichen Vertragsbedingungen. Die Vision des VAA ist eine zukunftsorientierte, innovative Arbeitswelt mit exzellenten Arbeitsbedingungen.

Dein Weg in eine Karriere mit Impact
Sarah Tegeler
Der Effektive Altruismus versucht Antworten darauf zu finden, wie wir mit unseren Ressourcen möglichst viel Gutes tun können. Unsere Karriere ist dabei einer der größten Hebel, um langfristig positive Veränderungen zu erreichen. Erfahre in dem Kurzvortrag, wie du deine beruflichen Ziele mit der Lösung globaler Probleme verbinden kannst.
Sarah Tegeler ist Co-Direktorin von Effektiver Altruismus Deutschland e.V. Der Verein bietet Programme und Beratung zur Karriereplanung mit Impact an und informiert über aktuelle Forschung zu den dringendsten globalen Problemen. Weiterhin begleitet und unterstützt er über 25 Lokalgruppen in Deutschland, zum Beispiel in Darmstadt.
Vor ihrem Engagement bei dem Verein hat Sarah in verschiedenen Stiftungen gearbeitet und dort die Förderung von sozialen und kulturellen Projekten begleitet. Sarah hat Kultur-, Medien und Festivalmanagement in Hamburg und Edinburgh studiert.